Resilienzen – Grundlagenwissen für die Vereinsführung

Bild: Adobe Stock
Resiliente Personen zeichnet unter anderem innere Stärke und die Fähigkeit, in einer Krise Chancen und Perspektiven zu erkennen, aus. Über diese Eigenschaften verfügen auch Vereinsmitglieder, -verantwortliche, Mitarbeiter:innen. Dieser Beitrag verschafft einen Überblick über diesen Themenkomplex.
Aus dem Vereinsalltag
Seit Enno P. zum ersten Vorsitzenden eines niedersächsischen Sportvereins gewählt wurde, weht ein frischer Wind. Der Unternehmer hat sich nach einem schweren Unfall, bei dem er seine Frau verloren hat, mühsam von seinen Verletzungen erholt und sich ins Leben zurückgekämpft. In dieser Zeit war sein Unternehmen den Bach runtergegangen. Nachdem er es zurück in die Erfolgsspur gebracht hatte, kam die Corona-Pandemie. Enno gab nicht auf. Die Geschäfte laufen wieder gut. Nun will er sich im Sportverein, in dem er seit seiner Kindheit Mitglied ist, engagieren.
Trotz seines Schicksals ist Enno das Gegenteil seines Vorgängers. Der hatte jede noch so gute Idee der übrigen Vorstandsmitglieder mit seinem Pessimismus infrage gestellt und blockiert. Zum Schluss hatte niemand mehr Lust, mit kreativen Vorschlägen das Ruder des Vereins nach den pandemiebedingten Einbrüchen herumzureißen. Enno hingegen ist ein Optimist, packt Probleme lösungsorientiert an. Er wägt zwar die Risiken ab, rückt aber im Hinblick auf neue Projekte die Chancen in den Fokus. Das im kommenden Monat anstehende Event sieht er für den Verein als Möglichkeit, wieder mehr ins Gespräch zu kommen, neue Mitglieder zu generieren, den sportlichen Ehrgeiz der Jugendlichen zu wecken, die Mitglieder als Gemeinschaft zusammenzuschweißen und gegebenenfalls einen kleinen Überschuss durch den Verkauf von Getränken und kleinen Snacks zu erwirtschaften. Sein Vorgänger hingegen hat die Meinung vertreten, man würde ohnehin keine Helfer finden, Zuschauer würden sich nicht für die Veranstaltung interessieren, das Event würde nur Verluste bringen und die Jugend habe ohnehin kein Interesse sich anzustrengen.
|
HÄUFIGE PROBLEME
Umgang mit Misserfolg Misserfolg im Verein kann dazu führen, dass Verantwortliche schnell resignieren. Dann macht der Verein keinen Schritt nach vorn, sondern lässt ihn unter Umständen in einen Abwärtsstrudel geraten. Pessimismus Wenn man statt Chancen nur die Risiken sieht, tritt man auf der Stelle. Durch das Verharren in alten Strukturen kann sich ein Verein nicht entwickeln. Fehlende Lösungsorientierung Viele Vereine agieren ohne konkrete Zielsetzung. Letzteres ist jedoch entscheidend für den Erfolg von Projekten, Aufgaben und Vorhaben. Mangelnde Zukunftsorientierung Lösungen haben häufig mit Veränderungen zu tun: „Das haben wir immer schon so gemacht“ ist in der Regel kontraproduktiv. |
Der Begriff
In der Physik beschreibt Resilienz die Fähigkeit eines Körpers, nach einer Veränderung der Form wieder in die Ursprungsform zurückzuspringen, bekannt als Elastizität. Mittlerweile hat der Begriff Resilienz in anderen Bereichen Einzug erhalten, wie in der Soziologie und Psychologie. In Letzterer geht es um die Fähigkeit des Menschen, Widerstandsfähigkeit in widrigen Situationen zu beweisen, beispielsweise mit Stress und Problemen umgehen zu können bzw. Krisen und Niederlagen zu bewältigen und daran zu wachsen. Somit ist in gewisser Weise mit Resilienz die seelische Elastizität eines Menschen gemeint. Als Synonyme werden häufig Begriffe, wie zum Beispiel Anpassungsfähigkeit, Belastbarkeit, Robustheit, Widerstandskraft, Zähheit, verwendet. Das Gegenteil von Resilienz ist Vulnerabilität, was die Verwundbarkeit von Menschen beschreibt.
|
HINWEIS Der Duden definiert Resilienz als psychische Widerstandskraft beziehungsweise die Fähigkeit, schwierige Lebenssituationen ohne anhaltende Beeinträchtigung zu überstehen. Das Wort leitet sich aus der lateinischen Sprache ab, „resilire“ kann mit zurückspringen, abprallen übersetzt werden. |
Beispiele für fiktive und reale resiliente Persönlichkeiten
Wir kennen Sie als Helden unserer Kindheit: Die Bremer Stadtmusikanten, Pipi Langstrumpf, Harry Potter. Es handelt sich um fiktive Figuren, die sich durch besondere Stärke auszeichnen, eine bewegende Lebensgeschichte haben, jedoch statt zu resignieren, ihr Schicksal in die Hand genommen haben.
Resiliente Persönlichkeiten gibt es nicht nur im Märchen oder in Heldengeschichten, sie begegnen uns ebenso im realen Leben:
Natascha Kampusch wurde 1998 im Alter von zehn Jahren entführt und rund acht Jahre lang im Keller eines Hauses gefangen gehalten. 2006 kann die inzwischen 18-Jährige fliehen. Sie holt unter anderem ihren Schulabschluss nach, tritt im Fernsehen auf, veröffentlicht ihre Autobiografie. Die Überschrift einer Rezession von Kim Kindermann hierzu lautet: „Eine Frau, die sich nicht zum Opfer machen lässt. […] Ihr Blick richtet sich immer auf eine Zukunft in Freiheit, egal, wie aussichtslos diese zeitweise scheint …“.
Samuel Koch: 2010 hatte sich Koch für die Fernsehshow „Wetten, dass?“ beworben. Bei dem Versuch, über ein fahrendes Auto zu springen, verletzte er sich so schwer, dass er seit diesem Zeitpunkt vom Hals abwärts querschnittgelähmt ist. Trotz seines Schicksals beginnt er ein Schauspielstudium und übernimmt heute unter anderem verschiedene Rollen in Theatern, engagiert sich für soziale Projekte.
Nelson Mandela: „Das Größte, was man erreichen kann, ist nicht, nie zu straucheln, sondern jedes Mal wieder aufzustehen.“ Dieses Zitat unterstreicht Mandelas Persönlichkeit. Als südafrikanischer Aktivist kämpfte er für Freiheit, gegen die Apartheid. Dieser Kampf hatte für ihn eine 27-jährige Haftstrafe zur Folge. Nach seiner Freilassung rief er zur Abkehr von der Apartheid auf. 1993 erhielt er den Friedensnobelpreis, 1994 wurde er zum ersten schwarzen Präsidenten seines Landes gewählt.
Die sieben Säulen
Es gibt verschiedene Modelle, die die Resilienz beschreiben, die jedoch teilweise in den Begrifflichkeiten abweichen. In vielen Modellen werden folgende Säulen genannt:
- Optimismus
- Lösungsorientierung (Zukunftsorientierung)
- Akzeptanz
- Netzwerkorientierung.
Die weiteren Begrifflichkeiten differieren, wobei jedoch trotz der unterschiedlichen Wortwahl alles auf die psychische Widerstandskraft der Menschen hinausläuft. So führt Prof. Heller (Expertin für Resilienz) „Selbstwirksamkeit, Verantwortung, Krisenerleben“ auf, Nuber (Dipl.-Psychologin) nennt ihre Säulen „Opferrolle verlassen, Verantwortung übernehmen, Zukunftsplanung“.
Bedeutung für den Verein
Was bedeuten Resilienz und deren Säulen für einen Verein? Zunächst einmal treffen in einem Verein die unterschiedlichsten Menschen aufeinander, resiliente Persönlichkeiten genauso wie verletzliche – darauf hat man keinen Einfluss. Starke Persönlichkeiten können das Vereinsleben ebenso prägen wie schwache. Während die einen in die Opferrolle flüchten und jammern („Immer laufen uns die Mitglieder weg“), akzeptieren die anderen Krisensituationen des Vereins zwar, packen jedoch die Probleme an, indem sie den Ursachen auf den Grund gehen (z. B. Kündigungen aufgrund unattraktiver Angebote), versuchen Lösungen zu finden und neue Wege zu gehen.
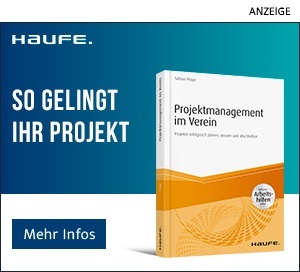
Lösungs- und Netzwerkorientierung
Lösungsorientiertheit akzeptiert Schwachpunkte „Ja, wir haben ein Problem.“ Hierbei wird jedoch nicht der Ist-Zustand in den Fokus gerückt, sondern die Möglichkeiten, sich von dem Problem zu lösen (Was können wir tun? Wer kann uns unterstützen?). Die letzte Frage zielt auf Netzwerkorientierung ab.
Oft sind Vereine nur deshalb erfolgreich, weil sie auf ein gutes Netzwerk zurückgreifen können. Netzwerke sind für Vereine somit unverzichtbar und sollten infolgedessen sorgfältig (!) gepflegt werden.
In Kontakt bleibt man bereits mit simplen Maßnahmen wie Einladungen zu Events, einem Weihnachtsgruß oder einem regelmäßigen Newsletter. Wer Netzwerke bislang nicht auf der Agenda hatte, sollte sich unbedingt über Netzwerkmanagement Gedanken machen.
|
HINWEIS Im Rahmen von Lösungsorientierung ist es hilfreich, ein präzises und gleichzeitig realistisches Ziel, möglichst terminiert und messbar, vor Augen zu haben. |
Nur wer Krisen aktiv begegnet und sich um eine Lösung bemüht, wird etwas verändern und sich aus einer unzufriedenstellenden Situation befreien können. Das ist in einer Gemeinschaft nicht anders als bei Einzelpersonen. Anders als bei Einzelpersonen müssen die Schritte der Zielerreichung jedoch sorgfältig abgestimmt werden (Wer tut was?).