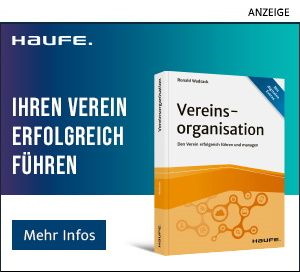Motivation von Mitgliedern und Ehrenamtlichen

Bild: Adobe Stock Inc.
Aus der Praxis
Für drei Tage findet ein Reitturnier auf der Anlage eines westfälischen Reitvereins statt. Dabei wird auch für das leibliche Wohl von Teilnehmern und Besuchern gesorgt. Pia, die neu im Verein ist, hat sich für die Mittagsschicht im Cateringzelt gemeldet, um Pflichtstunden abzuleisten. Karin kümmert sich seit Jahren um die Organisation rund um die Verpflegung. Sie schickt Pia, die eher an den Verkauf von Kaffee und Kuchen gedacht hatte, direkt zum Spülen. Nach zwei Stunden beauftragt sie die junge Frau, die Mülleimer auf dem Gelände zu leeren. Pia ärgert sich, da sie mit ihrer weißen Hose unpassend für die Müllentsorgung angezogen ist, traut sich jedoch nicht, das anzusprechen. Dass sie am Ende noch für das Glas Wasser, das sie zwischendurch getrunken hat, zur Kasse gebeten wird, findet sie empörend. Ihr ist klar, dass sie nie wieder freiwillig unter Karins „Kommando“ arbeiten wird, kurz sie ist demotiviert.
Ganz anders sieht es bei der gleichaltrigen Ina aus. Sie arbeitet in Brittas Gruppe, die für die Organisation der Starts und das Erstellen von Ergebnislisten zuständig ist. Britta lässt keinen Zweifel daran, wie froh sie über jede helfende Hand ist. Sie ist offen für Verbesserungsvorschläge, spart nicht an Lob, organisiert Getränke und Speisen für ihr Team. Am Ende bedankt sie sich bei Ina für die tolle Arbeit. Ina geht mit einem sehr guten Gefühl nach Hause und obwohl der Tag anstrengend war, wird sie Britta bei der nächsten Veranstaltung gerne wieder unterstützen.
|
HÄUFIGE SCHWIERIGKEITEN UND PROBLEME Anreiz Viele Menschen benötigen einen Anreiz, um aktiv am Vereinsleben teilzunehmen. Bedürfnisse Die Bedürfnisse der zu motivierenden Zielgruppe sind nicht immer bekannt. Das erschwert es, Anreize zu setzen. Demotivation Oft vergraulen Verantwortliche engagierte Mitglieder durch Besserwisserei oder durch das Abwälzen unbeliebter Arbeiten. Fehlender Respekt Ehrenamtlichen gegenüber fehlt es oft an Respekt. |
Der Motivationsbegriff
Laut Duden stammt der Begriff Motiv aus dem Lateinischen, von motivus, was wiederum für bewegend, antreibend (lateinisch motum = Antrieb) steht. Als Synonyme für Motivation werden häufig unter anderem Antrieb, Auslöser, Impuls,Beweggrund, Interesse, Triebkraft und -feder genannt. Wer andere motivieren möchte, muss zum Beispiel einen Ansporn schaffen oder Interesse wecken. Meistens ist der Begriff Motivation mit Positivem verbunden, was nicht bedeutet, dass Motive und Motivation auch negativ belegt sein können, beispielsweise Gemeinheiten oder Intrigen zum Ziel haben. Die Psychologie beschreibt mit Motivation die Hintergründe menschlichen Handelns. Gemeint ist damit die Orientierung des Verhaltens auf ein bestimmtes Ziel hin. Vereinfacht ausgedrückt geht es um unterschiedliche Faktoren, die Menschen antreiben, etwas zu tun oder zu unterlassen. Die Antriebskräfte kommen entweder von innen heraus (intrinsische Motivation) und/oder äußeren Quellen (extrinsische Motivation).
Motivation und Bedürfnisse
Anreize von außen können nur effizient gesetzt werden, wenn die Bedürfnisse der zu motivierenden Person/en bekannt sind. Unterschieden werden nach der „Maslowschen Bedürfnispyramide Selbstverwirklichung“ (als Spitze aller Bedürfnisse), Ich-Bedürfnisse, soziale Bedürfnisse, Sicherheits- und Grundbedürfnisse (Basis aller Bedürfnisse wie Essen oder Trinken). Im Vereinsleben werden in erster Linie Bedürfnisse oberhalb der Grundbedürfnisse angesprochen, oft handelt es sich um soziale Bedürfnisse.
Vereinsverantwortliche haben es mit sehr unterschiedlichen Gruppen, unter anderem mit aktiven sowie passiven Mitgliedern, Ehrenamtlichen, Sponsoren usw., zu tun. Innerhalb der einzelnen Gruppen gibt es unter Umständen wiederum ganz unterschiedliche Bedürfnisse und Vorstellungen. Entsprechend sind Motivationsanreize zielgruppengerecht einzusetzen. Sponsoren wollen mithilfe des Vereins ihren Bekanntheitsgrad steigern oder ihr Image verbessern. Ehrenamtliche möchten zum Teil einfach nur, dass es dem Verein gut geht, da sie sich der Gemeinschaft eng verbunden fühlen. Oft sollen auch persönliche Interessen realisiert werden, etwa soziale Motive befriedigen, zum Beispiel gemeinsam etwas schaffen oder informelle Beziehungen nutzen. Vielen reicht das Gefühl, gebraucht zu werden. Auch bei sportlich Aktiven gibt es enorme Unterschiede.
Hier kann wie folgt differenziert werden:
- Spiel- bzw. Bewegungsmotiv (Sport macht Spaß)
- Gesundheitsmotiv (Sport ist gesund)
- Leistungsmotiv (etwas erreichen, zum Beispiel einen Wettbewerb gewinnen)
- Anschlussmotiv (soziale Kontakte durch Sport).
Zusammenspiel von Motivation und Zielen
Die vorangegangenen Ausführungen zeigen: Motivation hat mit Zielen zu tun, soll heißen, die Verantwortlichen müssen nicht nur Kenntnis über die Bedürfnisse der zu motivierenden Gruppe haben, sondern auch über deren Ziele. Hier ist Fingerspitzengefühl gefragt, denn die Ziele des Vereins müssen mit den Zielen der zu motivierenden Personen kompatibel sein. Bietet ein kleiner Verein beispielsweise Leichtathletik in Form von Breitensport, bei dem die Leute sich bewegen und Spaß haben wollen, an, passen diese Ziele nicht zu Leistungssportlern, die olympisches Gold gewinnen oder sich zumindest in der Weltspitze etablieren wollen.
Darüber hinaus müssen die Ziele so gewählt werden, dass sie erreichbar sind. Werden Ziele zu hoch gesteckt und sind daher nicht realisierbar, kann das Demotivation zur Folge haben.
Hilfreich sind im Rahmen der Zielsetzung zudem Zwischenziele, insbesondere bei Leistungsmotivation (zum Beispiel Erreichen von angestrebten Weiten oder Zeiten im Sport, der Sieg in einem wichtigen Wettkampf oder das Spielen eines schwierigen Musikstücks mit einem Musikinstrument).
|
HINWEIS Bei der Realisierung von Leistungszielen spielt zudem der Wille eine entscheidende Rolle. |
Motivation fördern
Viele Menschen unterliegen dem Irrglauben, dass ihre eigenen Motivatoren gleichermaßen für andere gelten. Um andere motivieren zu können, bedarf es vielmehr einer guten Portion an Empathie, um Bedürfnisse und Ziele der zu motivierenden Personen erkennen zu können. Im Grunde gilt es im Vorfeld unter anderem diese zentralen Fragen zu klären:
- Wer beziehungsweise welche Gruppe soll motiviert werden?
- Welche Ziele und Bedürfnisse der Gruppe werden angesprochen?
- Wird mit einem kurz- oder langfristigen Ziel gearbeitet?
- Sind Zwischenziele sinnvoll, wenn ja, welche?
- Wie können Über- beziehungsweise Unterforderung vermieden werden?
Obwohl man stark nach Bedürfnissen und Zielen der verschiedenen Interessengruppen differenzieren muss, gibt es generelle Faktoren, die sich als Motivatoren eignen. Dazu gehören unter anderem:
- Persönliche Ansprache, Anerkennung und Lob
- Vermitteln von Sicherheit
- Ängste reduzieren (zum Beispiel Angst vor Misserfolg)
- Rückmeldung und Zuwendung
- Hilfestellung bei Problemen und Schwierigkeiten
- Übertragen von Verantwortung
- Schaffen von Erfolgsanreizen (Belohnung)
- Fördern sozialer Beziehungen
- Neue Aufgaben (um Neugier und Interesse zu wecken)
- Erfolgswahrscheinlichkeit
- Auszeichnungen und Ehrungen
- Pressearbeit (Berichte über Engagement und Leistung).
Welche Faktoren vom Einsatz kommen, hängt unter anderem von der Zielgruppe und den Zielen, die mit der Motivation verfolgt werden, ab. Bei Sportlern wird man vermehrt auf die Erfolgskomponenten setzen, wobei Erfolg häufig mit gesellschaftlicher Anerkennung verbunden ist. Konkrete Anreize können beispielsweise das Austragen von Wettkämpfen auf der Vereinsanlage (Heimvorteil), das Aufrücken in einen Kader, die Zusammenstellung von Trainingsgruppen (Konkurrierende puschen sich gegenseitig) sein. In anderen Bereichen setzt man vermehrt auf Events, die Gesangstruppe zum Beispiel spornt man durch die Teilnahme an einem Konzert an.
Da Ehrenamtliche völlig andere Ziele anstreben als Aktive, unterscheiden sich die Motivatoren. Oft bedarf es hier gar nicht viel, das Dankeschön an die Ehrenamtlichen oder eine Gratulation zum Geburtstag, Genesungswünsche im Krankheitsfall drücken Wertschätzung aus, sind schnell erledigt und haben oft eine große Wirkung. Oder die gemeinsame Aufräumaktion der Vereinsanlage schließt man mit einem geselligen Beisammensein beim Grillen oder einem Kaltgetränk.
|
HINWEIS Es besteht grundsätzlich die Gefahr, dass die Motivation nachlässt, wenn die Belohnung wegfällt. |
Demotivation
Genauso wie es Faktoren gibt, die motivieren, gibt es demotivierende Einflüsse. Hier ist wiederum gruppenspezifisch zu differenzieren. Sportler können beispielsweise durch Über- und Unterforderung im Training, falschen Zielen, Wettkämpfen mit „nicht-Vergleichbaren“, die Kapelle durch ein zu schwieriges Musikstück, die Theatergruppe durch ein langweiliges Stück demotiviert werden.
Kaum zu toppen in Sachen Demotivation von Ehrenamtlichen dürften Sprüche wie „Das haben wir immer schon so gemacht.“ sein, die leider immer wieder zum Einsatz kommen. Da springen engagierte Leute schnell ab. Wichtig ist es auch, das Bewusstsein zu schaffen, dass Ehrenamtliche keine Bittsteller sind und in keinem Fall als solche behandelt werden dürfen. Weiter demotivierende Faktoren (vgl. auch Eingangsbeispiel) sind beispielsweise
- Besserwisserei, Arroganz und Überheblichkeit,
- einsame Entscheidungen,
- mangelndes Feedback,
- fehlende Bereitschaft zuzuhören,
- Über- und Unterforderung,
- unliebsame Routinen und Aufgaben.
Fazit
Wer motivieren will, muss sich seiner Zielgruppe bewusst sein. Sind die Menschen, die motiviert werden sollen, nicht bekannt, wird es kaum möglich sein, die richtigen Anreize zu setzen.
Insbesondere im Umgang mit Ehrenamtlichen sind Umsicht und Sensibilität wichtig.