Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Vereinsarbeit
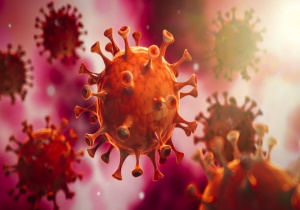
Bild: Adobe Stock, Inc.
Die Folgen der Pandemie und die Regelungen in den einzelnen Bundesländern haben auch auf Vereine und Verbände bisher ungeahnte Auswirkungen, da der Betrieb von heute auf morgen fast auf null heruntergefahren werden musste. Die Folge sind rechtliche Fragen und Probleme in allen Bereichen, wie dies auch in der Privatwirtschaft der Fall ist. Viele Fragen konnten z. B. anhand der Satzung nicht gelöst werden.
Der Bundestag hat daher in einem Eilverfahren am 25. März 2020 diverse Änderungen im Vereinsrecht beschlossen, die im „Gesetz zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht“ zusammengefasst sind (Bundestag-Drucksache 19/18110 vom 24.03.2020).
Das Gesetz wurde noch am 27. März 2020 im Bundesanzeiger veröffentlicht und ist am 28. März 2020 in Kraft getreten.
Handlungsfähigkeit des Vorstands
In vielen Vereinen war die Amtszeit des Vorstands abgelaufen und es standen turnusmäßig Neuwahlen an. Da diese nicht stattfinden konnten, stellt sich die Frage der Handlungsfähigkeit des Vorstands und des Vereins, die der Gesetzgeber in diesem Jahr durch eine Übergangsregelung geheilt hat, wonach sich die Amtszeit bis zur nächsten regulären Wahl automatisch verlängert, auch wenn dies die Satzung nicht vorsieht.
Problem Mitgliederversammlung
Viele Mitgliederversammlungen mussten abgesagt werden bzw. können derzeit nicht geplant oder terminiert werden. Folge ist, dass in vielen Vereinen Vorstandswahlen nicht stattfinden oder sonstige wichtige Entscheidungen oder Beschlüsse nicht getroffen werden konnten.
Alternative 1: Virtuelle Mitgliederversammlung
Das BGB-Vereinsrecht (§ 32 Abs. 1 BGB) geht davon aus, dass die Mitgliederversammlung als sog. Präsenzversammlung stattfindet, d. h., die Mitglieder kommen physisch in einem Raum zu einer Versammlung zusammen, um die erforderlichen Beschlüsse nach der Tagesordnung zu fassen.
Da dies derzeit nicht möglich ist, hat der Gesetzgeber als Übergangsregelung für 2020 die virtuelle Mitgliederversammlung geschaffen. D. h., es muss eine Mitgliederversammlung – allerdings im Wege der elektronischen Kommunikation – stattfinden.
Mitglieder, die aus technischen Gründen nicht an der virtuellen Mitgliederversammlung teilnehmen können, können ihre Stimmen schriftlich im Wege einer ergänzenden „Briefwahl” abgeben.
Alternative 2: Keine Mitgliederversammlung – Beschlussfassung im Umlaufverfahren
Das Gesetz sieht als weitere Alternative – auch wiederum nur befristet für das Jahr 2020 – das schriftliche Umlaufverfahren für die Mitglieder vor, auch wenn dies die Satzung des Vereins derzeit so nicht vorsieht. In diesem Fall findet also keine Mitgliederversammlung statt. Allerdings müssen nach § 5 Abs. 3 des genannten Gesetzes bestimmte Verfahrensschritte genau eingehalten werden, damit eine wirksame Beschlussfassung nach diesem Verfahren möglich ist.
Durchführung von Vorstandssitzungen
Nach den derzeitigen Anordnungen in den einzelnen Bundesländern können auch keine Vorstandssitzungen stattfinden. Dieses Thema hat der Gesetzgeber nicht ausdrücklich im o.g. Gesetz geregelt. Wenn sich die Vorstandsmitglieder daher einig sind, können sehr wohl Vorstandssitzungen im Rahmen einer Video- oder Telefonkonferenz stattfinden oder Beschlüsse z. B. im Umlaufverfahren per E-Mail getroffen werden.
Fristlose Kündigung der Mitgliedschaft zulässig?
Hier sind sich die Fachleute einig: auch wenn derzeit der Vereinsbetrieb ruht und die Mitglieder ihren üblichen Aktivitäten im Verein nicht nachgehen können, ist dies kein Grund für eine fristlose Kündigung der Mitgliedschaft, da nach der Rechtsprechung kein wichtiger Grund vorliegt (§ 314 Abs. 1 BGB).
Läuft die Beitragspflicht weiter?
Viele Mitglieder kommen auf die Idee, ihre Beitragszahlungen einzustellen oder die Beiträge zurückzufordern, da der Vereinsbetrieb derzeit eingestellt ist. Nach der aktuellen Rechtsprechung ist dies nicht möglich. Die finanziellen Verpflichtungen der Mitglieder erfolgen allein aufgrund der bestehenden Mitgliedschaft. Bei der Mitgliedschaft im Verein handelt es sich jedoch nicht um ein „Gegenseitigkeitsverhältnis”, dem ein Leistungsaustausch zugrunde liegt. Ein Mitglied kann daher seinen Beitrag nicht deshalb kürzen, weil der Vereinsbetrieb derzeit ruht.
Insolvenzantragspflicht verschoben
Wenn ein Verein in finanziellen Schwierigkeiten und zahlungsunfähig oder überschuldet ist, muss der Vorstand nach § 26 BGB den Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens stellen (§ 42 BGB). Eine Frist ist dazu im Vereinsrecht nicht vorgesehen, der Vorstand sollte sich jedoch an einer Drei-Wochen-Frist ab Scheitern der Sanierungsbemühungen orientieren. Der Gesetzgeber hat im Rahmen des o. a. Gesetzes geregelt, dass die Pflicht zur Antragstellung in diesem Jahr bis zum 30. September aufgeschoben ist.
Leistungsverweigerungsrecht bei Mietverhältnissen
Mietern und Pächtern kann für den Zeitraum vom 1. April bis 30. Juni 2020 nicht wegen ausgefallener Mietzahlungen aufgrund der Corona-Pandemie gekündigt werden. Die Miete bleibt für diesen Zeitraum weiterhin fällig; es können auch Verzugszinsen entstehen. Mietschulden aus dem Zeitraum vom 1. April bis 30. Juni 2020 müssen bis zum 30. Juni 2022 beglichen werden, sonst kann den Mietern wieder gekündigt werden. Mieter müssen im Streitfall glaubhaft machen, dass die Nichtleistung der Miete auf den Auswirkungen der Corona-Pandemie beruht. Diese Regelungen gelten auch für Vereine und Gewerberaummietverträge.
Gesetz zur Abmilderung der Folgen der Corona-Pandemie im Veranstaltungsvertragsrecht geplant („Gutscheinlösung“)
Die Bundesregierung plant eine weitere Gesetzesänderung für den Bereich des Veranstaltungswesens und für Freizeiteinrichtungen.
Aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus und der damit verbundenen Veranstaltungsverbote wurde ein Großteil der geplanten Musik-, Kultur-, Sport- und sonstigen Freizeitveranstaltungen abgesagt und Freizeiteinrichtungen bleiben geschlossen.
Eine Vielzahl von bereits erworbenen Eintrittskarten für die unterschiedlichsten Freizeitveranstaltungen kann aufgrund der notwendigen Absagen nicht mehr eingelöst werden. Museen, Freizeitparks oder Schwimmbäder können aufgrund der erforderlich gewordenen Schließungen nicht mehr besucht werden.
Die Inhaber der Eintrittskarten oder Nutzungsberechtigungen wären daher nach geltendem Recht berechtigt, die Erstattung des Eintrittspreises oder Entgelts von dem jeweiligen Veranstalter oder Betreiber zu verlangen. Die Veranstalter und Betreiber wären in einem solchen Fall mit einem erheblichen Liquiditätsabfluss konfrontiert. Da sie infolge der Krise derzeit auch kaum neue Einnahmen haben, ist für viele eine die Existenz bedrohende Situation entstanden.
Die Veranstalter von Freizeitveranstaltungen werden daher berechtigt, den Inhabern der Eintrittskarten anstelle der Erstattung des Eintrittspreises einen Gutschein zu übergeben. Der Gutschein kann dann entweder für eine Nachholveranstaltung oder eine alternative Veranstaltung eingelöst werden.
Soweit eine Freizeiteinrichtung aufgrund der Corona-Pandemie zu schließen war, ist der Betreiber berechtigt, dem Nutzungsberechtigten ebenfalls einen Gutschein zu übergeben.
Der Inhaber des Gutscheins kann jedoch die Auszahlung des Gutscheinwertes verlangen, wenn ihm die Annahme des Gutscheins aufgrund seiner persönlichen Lebensverhältnisse unzumutbar ist oder wenn der Gutschein nicht bis zum 31. Dezember 2021 eingelöst wird.
Diese sogenannte „Gutscheinlösung“ soll nach Beschluss durch den Bundestag in Art. 240 EGBGB aufgenommen werden. Wann dies der Fall sein wird, war bei Redaktionsschluss noch nicht bekannt.
