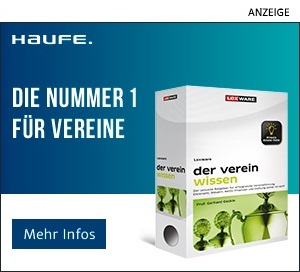Ist der Dirigent und künstlerische Leiter ein Arbeitnehmer?

Bild: Project Photos GmbH & Co. KG
Als Folge einer Lohnsteuer-Außenprüfung stufte das Finanzamt einen aktiven Dirigenten lohnsteuerrechtlich als Arbeitnehmer ein und verlangte hohe Nachzahlungsbeträge über Lohnsteuer-Haftungsbescheide gegenüber dem Konzertveranstalter und Auftraggeber in der Rechtsform einer gemeinnützigen GmbH.
Gegen die recht hohen Haftungsbescheide wurde fristgerecht Einspruch eingelegt und die Aussetzung der Vollziehung für die Nachforderungs-Steuerbeträge eingelegt.
Das Finanzgericht wies zwar die Beschwerde gegen die Haftungsbescheide zurück, die Beschwerde wurde wegen grundsätzlicher Bedeutung der Rechtssache zum Bundesfinanzhof ausdrücklich zugelassen.
Unabhängig von dieser verfahrensrechtlichen Situation wurden dem Finanzamt die Verfahrenskosten auferlegt, da nach Ansicht des FG separat vorrangig noch zu prüfen ist, ob überhaupt eine Arbeitnehmereigenschaft bei dieser künstlerischen Tätigkeit vorliegt und sich hieraus dann eine Pflicht zur Durchführung des Lohnsteuerabzugs ergeben kann.
Die Haftungsbescheide wurden zudem bis zum Ergehen einer abschließenden Einspruchsentscheidung diesbezüglich ausgesetzt.
Für dieses Finanzgericht war es daher ernsthaft zweifelhaft, ob entgegen der Auffassung des Finanzamts bei Chefdirigenten und künstlerischen Leitern überhaupt eine Arbeitnehmereigenschaft vorliegt. Denn bereits die Einordung des Vertragsverhältnisses ist in den verschiedenen juristischen Fachgerichtsbarkeiten umstritten.
Zunächst wies das FG darauf hin, dass eine finanzgerichtliche Entscheidung/ein Urteil hierzu noch nicht vorliegen würde.
Das FG führt hierzu verschiedene Entscheidungen an, u. a. des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs, mit der Aussage, dass die Chefdirigenten und künstlerischen Leiter als selbstständig Tätige einzustufen seien. Gerade auch mit der maßgeblichen Feststellung, dass für den Selbstständigkeitsstatus schon nach dem Vertragsverhältnis kein irgendwie geartetes Weisungsrecht sich ergeben würde, zudem die Tätigkeit insgesamt und auch die Arbeitszeit völlig selbst bestimmbar seien.
Demgegenüber gelangte bereits das Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen zur völlig gegensätzlichen Rechtsauffassung, dass ein Dirigent in der Regel im Spielbetrieb eingegliedert und damit abhängig beschäftigt sei, gerade wenn zusätzlich bestimmte vorgegebene Stücke und Konzerte inhaltlich aufgeführt werden müssten.
Fundstelle: Finanzgericht Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 13.01.2020, 9 V 9095/19
Anmerkung: Hiervon ausgehend wird nun wohl der Bundesfinanzhof die lohnsteuerliche Beurteilung vornehmen müssen. Ob sich die Sozialgerichte mit Blick auf die Sozialversicherungspflichten anschließen, muss abgewartet werden.
Sicherlich werden sich auch dann die Spitzenverbände im Sozialversicherungsbereich dieser Grundsatzfrage aus deren Sicht annehmen.
In vergleichbaren Fällen sollte unbedingt mit Hinweis auf das laufende BFH-Verfahren versucht werden, das Ruhen von Einsprüchen bis zur abschließenden BFH-Entscheidung zu erreichen.
Wobei gerade Verbände und gemeinnützige Großorganisationen diese nicht klare Rechtsfrage auch im Interesse der Beteiligten weiterverfolgen sollten.
Geht man auf die Ebene der meisten gemeinnützigen Musik- und Gesangsvereine, der Chöre und Gesangsgemeinschaften, so wird zur Abrechnung wegen des unterstellten Nebentätigkeitsstatus meist der Übungsleiterfreibetrag genutzt.
Fast überwiegend wird für diese nebenberufliche Tätigkeit als Dirigent für einen Musikverein, als Chorleiter eine nebenberuflich selbstständige Tätigkeit unterstellt und auch so durchgeführt und als Honorar ausgezahlt.
Somit wird alternativ durch den meist im Hauptberuf anderweitig tätigen Dirigenten/Chorleiter etc. selbst der Freibetrag für die nebenberuflich erzielten Einkünfte aus nebenberuflich selbstständiger Tätigkeit genutzt und berücksichtigt und in der eigenen ESt-Erklärung dieser Zusatzverdienst dann über die Anlage S offengelegt.